
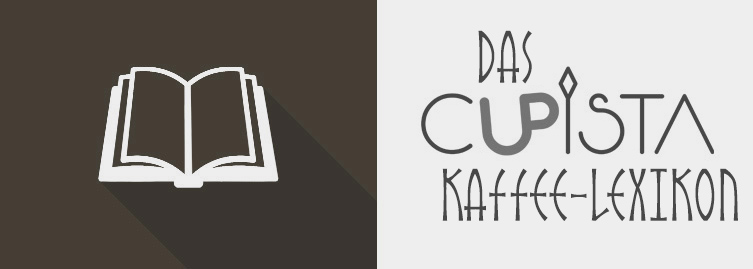
Gesundheit / Genussmittel
Bereits seit hunderten Jahren weiß man, dass der Sud aus gerösteten und zermahlenen Kaffeekirschen in Einfluss auf den Organismus nimmt. Insbesondere machte man sich seit jeher die belebende Wirkung des Koffeins zunutze. Als teure Importware galt Kaffee in Europa lange Zeit als Luxusgut und Genussmittel.
Aber Kaffee enthält neben dem Koffein noch viele Antioxidantien, also chemische Verbindungen, die die Zellen vor freien Radikalen schützen.
Beeinträchtigt der abendliche Kaffee die Nachtruhe? Ja, Koffein stimuliert das zentrale Nervensystem und somit die körperlichen und geistige Leistungsfähigkeit, so beispielsweise positiv in Prüfungssituationen oder bei depressiver Gemütslage auswirken. Das Koffein wird von den Organen unterschiedlich schnell abgebaut, sodass es durchaus einen Zusammenhang zwischen Kaffeegenuss und Schlaflosigkeit geben kann. Kaffee allein macht nicht abhängig, man entwickelt jedoch mit der Zeit eine gewisse Toleranz gegenüber der Wirkung des Koffeins. Insbesondere wenn der Genuss von Cola, Tees und Energydrinks dazu kommt. Man sollte Koffein in Maßen zu sich nehmen.

Kaffee regt das Kreislaufsystem an, führt jedoch nicht pauschal zu Bluthochdruck. Ein erhöhtes Krebsrisiko oder Neigung zu Magengeschwüren ist bisher nicht belegt. Allerdings bringen Säuren, Gerb- und Bitterstoffe den Magen-Darm-Trakt in Wallung. Wer zu Sodbrennen neigt, greift am besten zu entkoffeiniertem Kaffee.
Frauen sollten während der Schwangerschaft sicherheitshalber ihren Kaffeekonsum einschränken. Aber gegen eine gelegentliche Tasse Direct-Trade Kaffee ist aber nichts einzuwenden.
Kaffee besteht zu 99 % aus Wasser. Die Aussage, dass Kaffee dem Körper Flüssigkeit entziehe, kann deshalb nicht bestätigt werden. Er regt die Urinbildung und den Harnfluss an.
Bei Parkinson mangelt es dem Körper / dem Gehirn an Dopamin. Bei Demenz oder Alzheimer nimmt die Leistungsfähigkeit des Gehirns durch den Alterungsprozess des Körpers ab. Man hat herausgefunden, dass in allen Fällen der regelmäßige Kaffeekonsum in gewisser Weise einen schützenden Effekt haben kann. Ähnliche Ergebnisse zeigen Untersuchungen in Bezug auf die Risiken, an Diabetes Typ 2, an Leberzirrhosen oder an Gallen- und Nierensteinen zu erkranken. Welche Stoffe dafür verantwortlich sind, ist bisher aber noch nicht geklärt.

